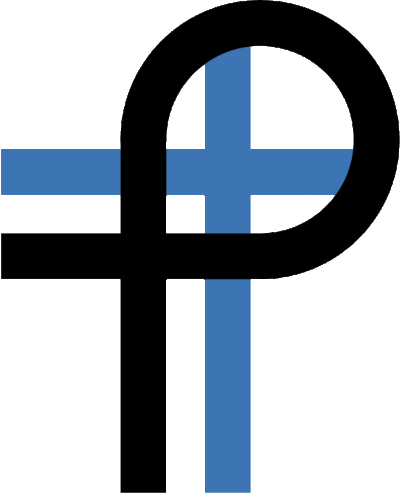Wenn der Kirchenraum nicht mehr passt
Mit dem Rückgang der Gottesdienste und Gottesdienstbesucher wie generell der Pfarreiangehörigen stellt sich die Frage, welche kirchlichen Räume für die Zukunft erhalten und wie sie genutzt werden sollen. Es handelt sich um eine anspruchsvolle Auseinandersetzung, wobei nebst personellen, finanziellen und rechtlichen Fragen viele Emotionen mitspielen. Die Schweizer Bischöfe haben dazu ein Pastoralschreiben vorgelegt, das die Zusammenhänge in den Blick nimmt.
Das Motto der Inländischen Mission lautet «Damit die Kirche im Dorf bleibt». Dafür machen wir uns dank der grosszügigen Unterstützung unserer Spenderinnen und Spender sowie Gönnerinnen und Gönner seit über 160 Jahren stark. Doch seit einiger Zeit bekommt dieser Slogan eine neue Bedeutung. Viele Kirchen sind für die sonntägliche Gottesdienstgemeinde viel zu gross. Der Unterhalt von Kirchen und Kapellen, ebenso wie von Kirchgemeindezentren oder Pfarrhäusern, bleibt aber gross. Zudem treten immer mehr Leute aus der Kirche aus, was sich unmittelbar auf den Steuerertrag der Kirchgemeinden auswirkt. Und die Alterskurve der katholischen Bevölkerung zeigt auf, dass die Mitgliederzahlen auch auf natürliche Weise zurückgehen werden.
Kirchen schenken Identität
Rückläufig ist auch die Zahl der Mitarbeitenden in der Seelsorge und in kirchlichen Dienststellen. Wo Wohn- und Büroräumlichkeiten im Eigentum der Kirchgemeinden sind, lassen sich diese heutzutage vermieten oder gar verkaufen. Damit lassen sich für die Zukunft bedeutende Einnahmen erschliessen. Bei Kirchen und Kapellen ist das eine ganz andere Sache. Sie können – und sollen – als Bauten nicht ohne weiteres umgenutzt werden. Sie sind vielmehr Ausdruck einer religiösen und kulturellen Entwicklung (und stehen oft unter Denkmalschutz), sie sind Zeuge sakraler und pastoraler Veränderungen, und nicht zuletzt sind sie ein bedeutendes Identifikationsobjekt für die Bevölkerung. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass bei Umfragen zur religiösen Bindung selbst Personen, die aus der Kirche ausgetreten sind, noch eine starke Bindung zu «ihrer» Kirche zum Ausdruck bringen.
Früh das Gespräch suchen
Neu ist die Diskussion um Um- oder Mehrfachnutzungen von Kirchen nicht. Es gibt bereits gute Beispiele, wo es gelungen ist, das Gesamtpaket der Immobilien einer Pfarrei zu beurteilen, nicht mehr benötigte Räumlichkeiten zu vermieten oder zu verkaufen und sich auf einen finanziell abgesicherten Erhalt einer Kirche oder eines Zentrums zu konzentrieren. Doch Rezepte gibt es keine. Viel zu unterschiedlich ist die Ausgangslage in der Seelsorge, der Verwaltung und bei den rechtlichen Grundlagen.
So muss jedes Zukunftsprojekt für Kirchen neu angegangen, aber nicht neu erfunden werden! In ihrem Schreiben verweisen die Bischöfe auf eine Praxishilfe der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothum aus dem Jahr 2019, was zeigt, dass diese Fragen keine Konfessionsgrenzen kennen. Ein vergleichbares Schreiben mehrerer katholischer Bistümer und evangelischer Kirchen aus Deutschland ruft sogar dazu auf, diese Prozesse in ökumenischer Verbundenheit zu gestalten und die Planungen aufeinander abzustimmen. Verantwortliche aus Seelsorge und Verwaltung werden denn auch ermutigt, möglichst früh Fachleute und Personen beizuziehen, die bereits Erfahrungen mit Nutzungsplanungen für Kirchengebäude gemacht haben. Genauso wichtig sei es, dass die Pfarreiangehörigen und Kirchgemeindemitglieder informiert und in die Überlegungen einbezogen würden. Denn durch ihre «symbolische und historische Bedeutung vor Ort und oft auch darüber hinaus» bestehe ein öffentliches Interesse an Funktion und Erhalt von Kirchenbauten, heisst es im Pastoralschreiben. Die Denkmalpflege wird hier als «Anwältin dieses öffentlichen Interesses» bezeichnet.
Knackpunkt Eigentumsverhältnisse
Zudem spielen die Eigentumsverhältnisse eine zentrale Rolle. Kirchen und kirchliche Liegenschaften sind nicht zwingend Eigentum einer Kirchgemeinde oder Pfarrei. Nicht wenige bedeutende Gotteshäuser – beispielsweise die Jesuitenkirche in Luzern – gehören dem Kanton. Kapellen wiederum befinden sich oft im Eigentum von Stiftungen. Zudem weisen die Bischöfe daraufhin, dass mancherorts auch mit einem Kirchengebäude verbundene Verträge zu beachten seien.
Die Peterskapelle, die älteste Kirche in der Stadt Luzern, bietet Platz für Gottesdienste ebenso wie für vielfältige Begegnungen und Experimente. Hier wird die Kapelle für die Aufnahmen einer Talkshow genutzt.
(Foto: zvg/Jan Janutin)
Eine anspruchsvolle Auseinandersetzung birgt auch die Finanzfrage. Während pastorale und personelle Planungen auf Bistumsebene über Kantonsgrenzen hinaus erfolgen, sind den Bischöfen bei den Kirchenbauten die Hände gebunden: Die meisten Pfarrkirchen befinden sich im Besitz einer Kirchgemeinde. Diese sind es auch, welche die Kirchensteuern erheben. Wenn es in einer Seelsorgeeinheit darum geht, welche Kirchenräume wie genutzt werden können, spielen die Behörden mit Blick auf die Verwendung der Finanzmittel, aber auch mit ihrer Verpflichtung, dem Kirchengut Sorge zu tragen, eine bedeutende Rolle. Im Pastoralschreiben wird zudem auf Kirchgemeinden und Pfarreien hingewiesen, die für den Kirchenunterhalt auf Zuwendungen angewiesen sind. Hier gelte es, den Willen der Spendenden nach Möglichkeit zu respektieren. Die Inländische Mission ist in diesem Bereich seit über 160 Jahren engagiert und kann dieses Anliegen nur unterstützen. Den Bischöfen ist es ein Anliegen, dass Kirchenräume möglichst nicht aufgegeben werden. Diesen «Orte privilegierter Gottesbegegnung» müssten in angemessener Weise lebend erhalten und weiterhin liturgisch genutzt werden können. Deshalb wird im Pastoralschreiben auch eine Hierarchie allfälliger Neunutzungen empfohlen (siehe Kasten).
Jetzt über Zukunft nachdenken
Die Frage nach einer erweiterten Nutzung von Kirchenräumen zeigt sich hier vielleicht noch nicht so akut, wie etwa bei den Klöstern, wo zahlreiche Schliessungen anstehen. Angesichts der vielfältigen Ansprüche an ein solches Vorhaben wird aber schnell deutlich, dass eine angedachte «erweiterte Nutzung» von Kirchengebäuden, wo auch immer, kein Spaziergang ist.
Dass das Thema aber jetzt zum Gegenstand eines Pastoralschreibens gemacht wurde, ist deshalb nachvollziehbar. Wenn sich Verantwortliche in der Seelsorge und staatskirchenrechtliche Behörden sowie weitere Interessierte jetzt schon mit dem Thema befassen, wie beispielsweise an den Aargauer Kirchenpflegetagungen, kann vieles bereits einmal angedacht werden. Darauf lässt sich zurückgreifen, wenn es darauf ankommt.
Martin Spilker, Inländische Mission
Klare Rangfolge für Umnutzungen
Im Pastoralschreiben der Schweizer Bischöfe und Territorialäbte werden drei Möglichkeiten als erweiterte Nutzung von Kirchengebäuden unterschieden:
- Eine andere kirchliche Nutzung, beispielsweise durch geistliche Bewegungen, anderssprachige Gemeinden oder ökumenische Partnerkirchen, regionalkirchliche Arbeitsstellen, steht an erster Stelle. Aufgrund der symbolischen Strahlkraft sollten Kirchen und Kapellen jedoch nicht anderen Religionen zur Verfügung gestellt werden.
- An zweiter Stelle gilt es, kulturelle oder soziale Einrichtungen (z.B. Museum, Konzertraum, Ateliers, Kinderkrippe, Mittagstisch) zu prüfen. Auch hier setzt das Schreiben ein «Aber»: Solche Nutzungen dürften «nicht im Gegensatz zu humanitären werten des Evangeliums» stehen.
- Erst zuletzt und für Kirchenräume lediglich solche mit geringem kunsthistorischem wert könne eine Umnutzung für Wohnzwecke ins Auge gefasst werden. Andere kommerzielle Nutzungen werden für Kirchengebäude ausgeschlossen, seien bei Pfarreizentren aber denkbar.
Wenn immer möglich, sei bei der Abtretung von Kirchenbauten an Dritte die Vermietung vorzuziehen. Ein verkauf sei gar auszuschliessen, wenn befürchtet werden muss, dass das Bauwerk später so genutzt werde, dass dies mit den Prinzipien der Kirche unvereinbar wäre. Der Abriss einer Kirche oder Kapelle sollte nur in Ausnahmefällen in Betracht gezogen werden.
Das Pastoralschreiben zur Kirchenumnutzung
Schweizer Bischofskonferenz (Hrsg.): Wenn der Kirchenraum nicht mehr passt. Leitlinien für die erweiterte Nutzung von römisch-katholischen Kirchen, Kapellen und kirchlichen Zentren (- Pastoralschreiben 15). Freiburg 2024. Erhältlich bei der Schweizer Bischofskonferenz, Alpengasse 6, Postfach, 1701 Freiburg, oder im Internet unter www.bischoefe.ch unter der Rubrik Dokumente/Pastoralschreiben.
Bild oben: Die frühere Don-Bosco-Kirche in der Stadt Basel wurde 2016 von einem gemeinnützigen Verein zum Musik- und Kulturzentrum Don Bosco umgebaut Im gleichen Zug wurde im Untergeschoss des Gebäudes neu ein Gottesdienstraum der Pfarrei Heiliggeist errichtet. (Foto: zVg/Chr. Laser)